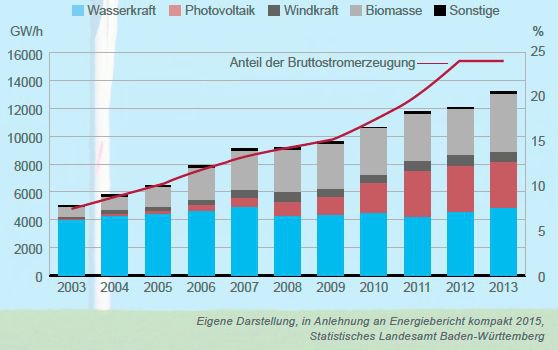Über bisherige Erfahrungen mit dem Ausbau sowie die Perspektiven für die Ausschreibungsmodelle sprechen Dr. Frank Güntert (Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft), Franc Schütz (EnBW AG) und Dr. Carsten Tschamber (Solar Cluster Baden-Württemberg e.V.).
Was erleben Sie als die größten Hürden beim Ausbau der Erneuerbaren Energien in Ihrer Berufspraxis?
Schütz: Grundsätzlich sehen wir eher den
erfolgreichen Fortschritt im Ausbau. Beim
Ausbau der Windenergie nehmen wir vor
allem im Süden aber auch zunehmend eine
schwindende Akzeptanz vor Ort wahr. Damit
steht die Windenergie aber nicht allein. Es
ist heutzutage normal, dass man eine intensivere
Diskussion mit der Gesellschaft um
viele Arten von Infrastrukturprojekten oder
Investitionen führen muss. Ärgerlicher ist die
politische Diskussion: Rahmenbedingungen
wie das EEG werden in immer kürzeren
Zeiten angepasst, notwendige Stabilität fehlt.
Wie wichtig der Umbau der Energieversorgung
gerade im Hinblick auf die Klimaentwicklungen
ist, gerät manchmal aus dem
Fokus.
Tschamber: Das sehe ich ähnlich. Insbesondere
bei der Photovoltaik (PV) ist das
schlechte Image der Technologie ein großes
Hindernis. Aufgrund der für alle Beteiligten
schädlichen Strompreisdiskussion sowie der
hektischen Förderkürzungen trotz drastisch
gefallener Systempreise wird die PV vielerorts
als wenig lohnend oder gar als Kostentreiber
angesehen. Dabei hat sich lediglich
das „Geschäftsmodell“ verändert: An die Stelle
einer reinen Einspeisung ins öffentliche
Netz treten zunehmend Modelle, in denen
der lokal erzeugte PV-Strom auch vor Ort
verbraucht wird. Dies ermöglicht unter anderem
die Versorgung von Mietern oder auch
Unternehmen mit langfristig günstigem
Strom.
Güntert: Bei aller Diskussion um die Systeme
– die größte Hürde ist aus meiner
Sicht noch immer das Denken in alten
Strukturen der Energieversorgung. Ein auf
Erneuerbaren Energien basierendes Energiesystem
muss grundsätzlich anders aussehen
als bisher. Oft wird beispielsweise die
Sicherheit der Stromerzeugung aus Windenergie
mit der Stromerzeugung fossiler
Kraftwerke verglichen. Das ist aber die
falsche Sichtweise. Das Gesamtsystem mit
sehr vielen dezentralen Energieerzeugern
und einer viel intelligenteren Regelung als
heute muss funktionieren.
In der Theorie sind Ausschreibungen ein effizientes Instrument zur Preisfindung. Was bedeuten die Ausschreibungsmodelle für den Ausbau der Erneuerbaren in Süddeutschland?
Güntert: Ob die Theorie auch in der Praxis
stimmt, muss sich erst noch zeigen. Im Ausland
haben Ausschreibungen bisher eher
schlecht funktioniert. Hauptmotivation der
Bundesregierung ist aber nicht der Preis. Mit
Ausschreibungen will sie die Geschwindigkeit
des Ausbaus der Erneuerbaren Energien
steuern. Welche Chancen Süddeutschland
im Wettbewerb zwischen den Regionen hat,
hängt entscheidend davon ab, wie die
Ausschreibungsmodelle gestaltet werden.
Momentan
sind Ausschreibungen nur für
große Photovoltaik- und Windenergieanlagen
geplant. Bei Photovoltaik wird es
darauf ankommen, welche Flächenkulisse
zugelassen wird, bei Windenergie wie unterschiedliche
Windhöffigkeiten und Standortbedingungen
berücksichtigt werden.
Schütz: Wir dürfen nicht vergessen, dass
der Ausbau der Erneuerbaren Energien in
Deutschland breit in der Gesellschaft verankert
ist. Wenn wir die Energiewende weiter
erfolgreich gestalten wollen, brauchen
wir Partizipationsmöglichkeiten, auch unter
den Stichworten „Akzeptanz vor Ort“ und
„Akteursvielfalt“. Die Einführung von Ausschreibungen
als Förderinstrument bedeutet,
dass ich wettbewerbliche Elemente
einführe, die – und das ist immanent – das
Risiko erhöhen. Damit erhöhe ich aber
auch das Risiko für Beteiligungen, z.B. von
Bürgern. Zudem hat die Einführung von Risiken
in der Fördersystematik natürlich
auch Auswirkungen auf die Kosten des
Ausbaus. Je höher das Risiko, desto höher
die Risikoaufschläge in den Projekten. Für
Süddeutschland sehe ich insbesondere
beim Onshore Ausbau erhebliche Herausforderungen,
da das Winddargebot eine
andere Technik verlangt als im windreicheren
Norden. Die Anlagen sind im Durchschnitt
höher und damit teurer, und auch
andere Umfeldbedingungen wie z. B. die Zuwegung gestalten sich aufwändiger.
Ein Ausschreibungssystem, das den
weiteren und sinnvollen Ausbau der
Windenergie
auch im Süden sicherstellen
will, muss dies in ausreichender
Form berücksichtigen.
Güntert: Ihre Argumente sind berechtigt
– das derzeitige Referenzertragsmodell
gleicht die unterschiedlichen
Windverhältnisse tatsächlich nicht genügend
aus. Das ist unstrittig und die Diskussion
dreht sich momentan eher um
die Art der Anpassung. Das Referenzertragsmodell
alleinig betrachtet kann
noch nicht den auch von der Bundesregierung
gewollten regional ausgewogenen
Zubau der Windenergie an Land sichern.
Wir fordern deshalb eine Quotierung der
Ausbauleistung für den Norden Deutschlands
einerseits und Süd- und Mitteldeutschland
andererseits. Dieser Vorschlag
fand im Bundesrat bereits eine Mehrheit.
Tschamber: Ich denke auch, dass man
regional differenzieren muss. In den bisherigen
Auktionsrunden wurden die
meisten PV-Anlagen im Nordosten
Deutschlands bezuschlagt, lediglich wenige
in Baden-Württemberg. Im Sinne
des Netzausbaus und auch wegen der
höheren Sonneneinstrahlung wäre es
jedoch sinnvoller, Anlagen in räumlicher
Nähe der südlichen Verbrauchszentren
zu errichten. Dazu muss allerdings die
Flächenkulisse erweitert und insgesamt
die Menge an ausgeschriebener Leistung
deutlich erhöht werden.
Wie kann Akteursvielfalt gewährleistet werden?
Tschamber: Die gegenwärtige Regelung
für PV-Freiflächenanlagen benachteiligt
durch die Komplexität des Verfahrens
gerade kleinere Akteure wie Energiegenossenschaften,
die bislang einen großen
Anteil am Ausbau der Erneuerbaren
Energien in Deutschland hatten. So haben
in den letzten Auktionsrunden zwar
einige Genossenschaften teilgenommen,
jedoch nur in Einzelfällen einen Zuschlag
erhalten. Für die Bundesregierung wiederum
reicht alleine die Teilnahme bereits
aus, um die Forderung nach mehr
Akteursvielfalt als erfüllt anzusehen.
Güntert: Und nicht nur Energiegenossenschaften,
kleinere Anbieter im Allgemeinen
benötigen vor allem die Sicherheit,
bei einer Ausschreibung überhaupt
einen Zuschlag zu erhalten, da sie andernfalls
die Vorlaufkosten des gescheiterten
Projekts nicht auf mehrere erfolgreiche
Projekte verteilen können. Ohne
diese Sicherheit werden Sie das Risiko
einer Projektentwicklung nicht eingehen.
Wir schlagen deshalb vor, dass kleinere
Akteure immer einen Zuschlag zum
Markträumungspreis erhalten.
Schütz: Ich halte nichts von Ausnahmeregelungen.
Wir brauchen faire Ausschreibungsbedingungen,
die es auch kleineren
Bietern ermöglichen, teilzunehmen. Ein
Ausschreibungssystem muss so ausgestaltet
sein, dass keine Marktversperrung
für Akteure stattfindet. Dass es für alle
anstrengender sein wird, ist aber systemimmanent.
Zunehmende Proteste vor Ort gegen Ausbauprojekte erwecken den Eindruck, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung für Erneuerbare Energien schwindet.
Güntert: Die Erfahrung mache ich nicht.
Der Großteil der Bevölkerung akzeptiert
den Ausbau der Erneuerbaren Energien.
Tschamber: Den Eindruck habe ich
auch nicht. Umfragen zeigen, dass die
Akzeptanz in der Bevölkerung unverändert
sehr hoch ist. Wichtig ist hier, wie
bei allen Infrastrukturprojekten, die frühzeitige
und offene Kommunikation mit
allen Interessengruppen.
Schütz: Und wichtig ist weiterhin, dass
wir an der Zukunft, der Generationenaufgabe,
uns nachhaltig mit Energie zu
versorgen, arbeiten. Dazu gehört der
Diskurs mit der Gesellschaft, den wir gerne auch vor Ort führen.